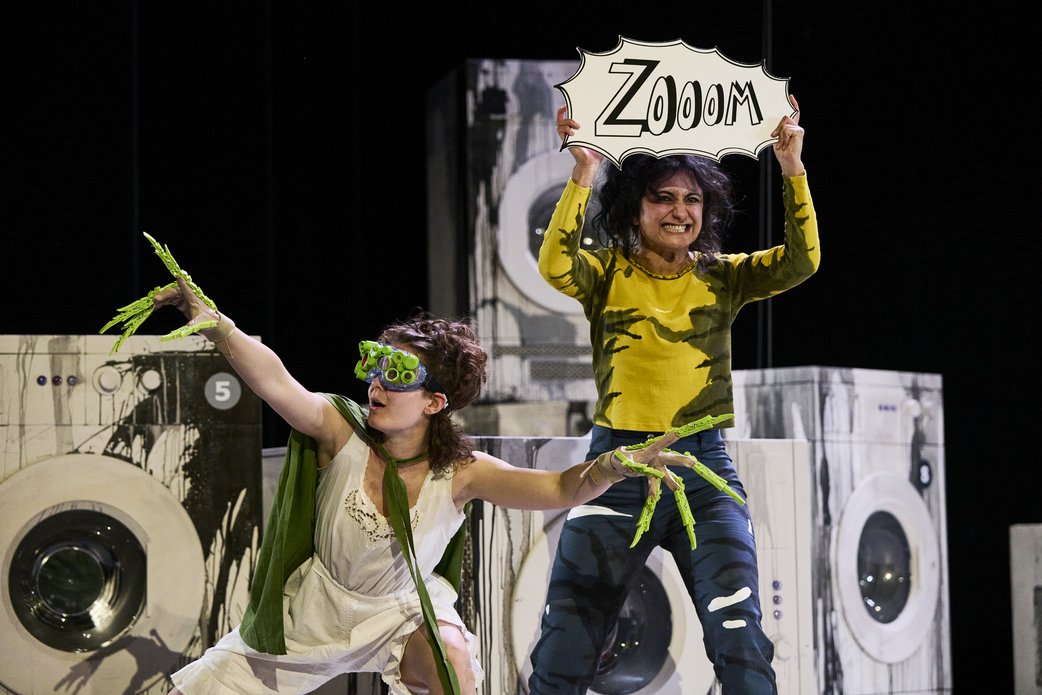die Südwind-Bloggerinnen
Judith Falentin
Südwind.Blog
Svenja Plannerer
Südwind.Blog
Marie-Luise Wenzel
Südwind.Blog
Anne Fritsch
Leitung Südwind.Blog